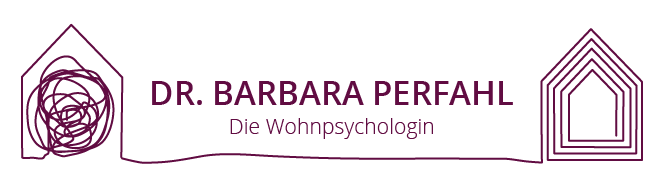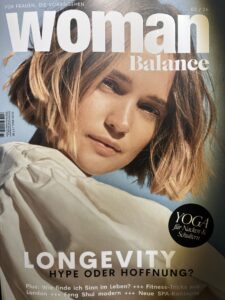Wohnpsychologie und Feng Shui
Häufig ist eine der ersten Reaktionen, wenn ich jemandem von meinen Beruf erzähle, der Satz: „Ach, dann machen Sie so was wie Feng Shui?“.
Feng Shui beschäftigt sich ja bekanntermaßen, zumindest in unseren Breiten, mit dem Thema Raumgestaltung. Es hat sich eine Zeit lang sogar der Begriff „Raumpsychologie“ für Feng Shui durchgesetzt. Haben denn Feng Shui und Wohnpsychologie etwas miteinander zu tun? Sind sie vielleicht sogar verwandt oder gar das Selbe?
Ich kann schon einmal vorwegnehmen: Das Selbe sind Wohnpsychologie und Feng Shui nicht.

Ich bin keine Feng Shui Expertin, weiß aber Folgendes:
Feng Shui ist eine aus China stammende Philosophie oder auch „Kunst und Wissenschaft vom Leben in Harmonie mit der Umgebung“. Danach verbindet und durchströmt die Energie Chi alles im Universum miteinander. Ein optimaler Energiefluss ist demnach für unser Wohlbefinden wichtig. Feng Shui versucht nun den Chi-Fluss eines Ortes zu erkennen und zu lenken, also in Wohn- oder Arbeitsräumen, aber auch zum Beispiel in Gärten. Feng Shui steht auch in Verbindung mit der traditionellen chinesischen Medizin, wo es um den Chi-Fluss im Körper geht.
Es geht im Feng Shui – über das Wohnen hinaus – um ein harmonisches Leben im Einklang mit der Umwelt, ja mit dem Universum. Das Thema Wohnen ist nur ein Teil davon. Insofern ähnelt es der Wohnpsychologie, die ja als Teilbereich der Psychologie auch in ein umfassenderes Wissensgebiet eingebettet ist.
Feng Shui ist Teil der chinesischen Kultur und viele der häufig im Zusammenhang mit Feng Shui zu lesenden oder hörenden „Gesetze“ oder „Wirkungsweisen“ klingen – zumindest für westliche Vorstellungen – eher willkürlich oder vielleicht sogar seltsam. Als ein Beispiel sei der immer wieder beschriebene Mechanismus genannt, dass Wasser, welches an der Rückseite eines Hauses vorbeifließt, Energie absauge, die dann zu Kraftlosigkeit bei den Bewohnern führe. Institutionen, die in solchen Gebäuden ihr Quartier haben, würden dadurch einen Machtverlust erleiden. Das ist für uns (für mich jedenfalls) schwer nachvollziehbar.
Dies liegt sicherlich daran, dass Feng Shui neben einem geomantischen Aspekt (das heißt es geht um die Energie eines Ortes), ursprünglich vor allem einen religiösen Charakter hatte. Es kann also letztlich als Glaubenssystem betrachtet werden, das die kosmischen Zusammenhänge beschreibt. Erfolg oder auch Wohlbefinden sind darin abhängig von kosmischen Kräften, und nicht zuletzt die Ausrichtung von Siedlungen und Häusern an der Umwelt ist dafür ausschlaggebend, ob diese Kräfte richtig gebündelt und geleitet werden können. Die Regeln, wie diese Kräfte geleitet werden können, betreffen aber nicht nur die Ausrichtung von Häusern, sondern auch die Anordnung der Räume im Haus, ja sogar die Position und Ausrichtung der Möbel.
Die Wohnpsychologie hingegen hat ihre Wurzeln in westlich-wissenschaftlichen Konzepten, auch wenn sie in ihrer Anwendungsorientierung und weil sie von den Bedürfnissen des Menschen ausgeht, für den Nutzer wenig wissenschaftliche „Schwere“ hat. Die Konzepte, Ideen und Erkenntnisse entstammen aber einer wissenschaftlichen Betrachtung der Mensch-Umwelt-Beziehung.
Interessanterweise habe ich in Gesprächen mit Feng Shui-Beratern des öfteren festgestellt, dass bei einem bestimmten Wohnproblem eine Feng Shui-Beratung und eine wohnpsychologische Beratung zu ähnlichen Empfehlungen in bestimmten Punkten kommt. Aus meiner Sicht scheint Feng Shui als Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Erfahrungswissenschaft auch grundlegenden Bedürfnisse des Menschen im Bereich des Wohnens abzubilden, genau wie dies die Psychologie tut.
Der wesentliche Unterschied ist für mich, dass es im Feng Shui, so wie es hierzulande meist betrieben wird, bestimmte feststehende Maßnahmen und Regeln gibt, die unabhängig von den betroffenen Personen umgesetzt werden können. Ein Unbehagen in Räumen oder Wohnprobleme werden dann direkt auf Störungen im Chi-Fluss zurückgeführt, welche mit bestimmten einfachen Maßnahmen behoben werden können. Und zwar unabhängig von den Personen, die in den Räumen leben. Es werden dann Kristalle oder Spiegel aufgehängt, Zimmerpflanzen mit runden statt eckig geformten Blättern empfohlen und die Himmelsrichtungen bei der Positionierung der Möbel einbezogen, weil im Feng-Shui bestimmte Stellen im Haus für bestimmte Lebensthemen stehen.
Als Psychologin gehe ich hingegen immer vom Menschen selbst aus, vom Individuum mit seiner ganz speziellen Persönlichkeit, seinen Lebensumständen und indivdiuellen Wohnbedürfnissen, um gemeinsam mit ihm ein Wohnproblem zu lösen. Auch die Wohnpsychologie verfügt über bestimmte klare Konzepte, was Räume zu besseren Räumen macht. Gerade aus dem Bereich Wahrnehmungspsychologie, also wenn es um Farben und Proportionen geht, gibt es auch universell geltende Gestaltungsregeln. Der Dreh- und Angelpunkt ist in der Wohnpsychologie aber immer der Mensch mit seiner Persönlichkeit, seiner Geschichte und seinen Bedürfnissen.
Kurz gesagt: Wohnpsychologie ist nicht Feng Shui.
Aber die beiden Themen passen sehr gut zueinander, weil sie oft das selbe Ziel haben: harmonische Räume, in denen Menschen sich wohlfühlen können.
PS: In der aktuellen Ausgabe des WOMAN Balance Magazins (3/25) gibt es zum Zusammenspiel von Wohnpsychologie und Feng Shui einen schönen Artikel.